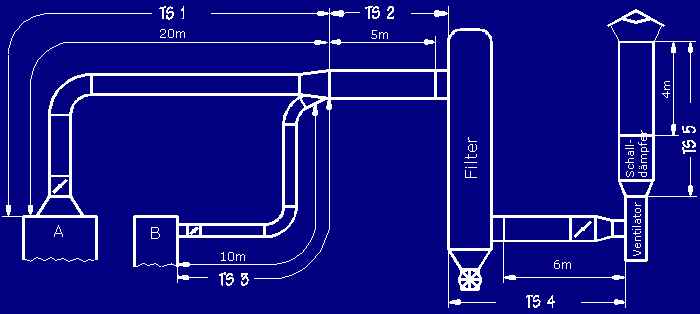
|
2.0 Beispiel Dimensionierung Normalfall 20° C, Luftdruck 1013 mbar (Meereshöhe). |
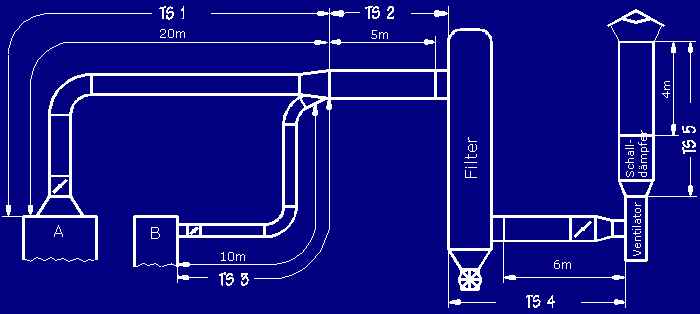
2.1 Ermittlung der abzusaugenden
Luftmenge (Volumenstrom)
Hinweise zur Bestimmung der Luftmengen siehe 9.0
| Absaugstelle A | 5000 m3/h (aus Herstellerangaben) | |
| Absaugstelle B | 2000 m3/h (aus Herstellerangaben) | |
| Volumenstrom gesamt (Vge) | 7000 m3/h |
|
2.2 Dimensionierung der Rohrdurchmesser
Unter Berücksichtigung der Mindestluftgeschwindigkeiten nach 3.1 können die erforderlichen Rohrdurchmesser der Tabelle 4 entnommen werden, alternativ auch aus Tabelle 5 wenn mit einem Volumenstrom in m3/min statt in m3/h gerechnet wird.
Für den Beispielsfall wurde eine Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/s angenommen.
Rohrsystem aufteilen in Teilstrecken
(TS), die gleiche Luftmengen (Volumenströme)
und gleiche Durchmesser aufweisen:
| TS 1: | Volumenstrom (V) = 5000 m3/h; | Durchm. 300mm | Luftgeschwindigkeit (w) cirka 20,0 m/s |
| TS 2: | Volumenstrom (V) = 7000 m3/h; | Durchm. 350mm | Luftgeschwindigkeit (w) cirka 20,5 m/s |
| TS 3: | Volumenstrom (V) = 3000 m3/h; | Durchm. 175mm | Luftgeschwindigkeit (w) cirka 23,5 m/s |
| TS 4: | Volumenstrom (V) = 7000 m3/h; | Durchm. 400mm | Luftgeschwindigkeit (w) cirka 15,5 m/s* |
| TS 5: | Volumenstrom (V) = 7000 m3/h; | Durchm. 450mm | Luftgeschwindigkeit (w) cirka 12,5 m/s** |
* Geringere Geschwindigkeit möglich, da
kein Produkt mehr im Luftstrom, das ausfallen könnte.
** Um Ausblasgeräusche geringer zu halten, kleinere Geschwindigkeit gewählt.
2.3 Ermittlung der Druckdifferenz pro Teilstrecke
Bei geraden Rohren Druckverlust je Meter (R) aus Tabelle 6 entnehmen.
Um den Druckverlust für Einzelwiderstände zu
bestimmen, muss der Zeta- Wert ( z )
nach 8.0 mit dem dynamischen Druck multipliziert werden. (Dp = z * pdy). Für den Normalfall wäre Dp = z * 0,6 * w2. |
Druckdifferenz
(D p) in TS 1: |
|||
| 20 m Rohr | R= 14,2 Pa/m | 20m * 14,2 Pa/m = | 284 Pa |
| 1 Ansaugstutzen | z = 0,2 | 1 * 0,2 * 240 Pa = | 48 Pa |
| 1 Drosselklappe | z = 0,2 | 1 * 0,2 * 240 Pa = | 48 Pa |
| 1 Bogen 90° | z = 0,28 | 1 * 0,28 * 240 Pa = | 67 Pa |
| 1 kon. Gabelstück 30° | z = 0,1 | 1 * 0,1 * 240 Pa = | 24 Pa |
Dp in TS 1 = |
471 Pa | ||
Druckdifferenz (D p) in TS 2:
V = 7000 m3/h; Æ 350; w = 20,5 m/s;
pdy= 252 Pa
5 m Rohr = 5m * 12,3 Pa/m = 62 Pa Druckverlust (Dp) für TS 2
Die weiteren Druckverlustberechnungen der Teilstrecken in Tabellenform:
Bezeichnung |
Stck |
z |
Stck*z |
Teilstr. Nr. 3 |
||
Ansaugstutzen |
1 |
0.50 | 0,50 | |||
Drosselklappe |
1 |
0,20 | 0,20 | V in m3/h 2000 |
||
Bogen 90° |
1 |
0,29 | 0,29 | |||
Bogen 60° |
1 |
0,20 | 0,20 | Æ
in mm 175 |
||
| w in m/s 23,5 |
||||||
Abzweigstück |
1 |
0,20 | 0,20 | Pdy in Pa (Normalfall 0,6*w2) 331 |
||
| Ausblasstutzen | ||||||
Einzelwiderstände: Summe Stck*z = |
1,39 | Þ * pdy = |
460 Pa | Dp Einzelw. | ||
| Rohr (10m lang) | l = 10 m |
R = 37 Pa/m |
l * R = |
370 Pa | Dp Rohr | |
| (Filter usw.) | 0 Pa | Dp Geräte | ||||
Druckdifferenz der Teilstrecke = |
830 Pa | Dp Summe | ||||
Bezeichnung |
Stck |
z |
Stck*z |
Teilstr. Nr. 4 |
||
Ansaugstutzen |
|
|||||
Drosselklappe |
|
V in m3/h 7000 |
||||
Bogen 90° |
|
|||||
Bogen 60° |
|
Æ
in mm 400 |
||||
| Konus (Æ geschätzt da Ventilator- | 1 | 0,56 | 0,56 | |||
| größe noch nicht bekannt) | w in m/s 15,5 |
|||||
Abzweigstück |
|
Pdy in Pa (Normalfall 0,6*w2) 144 |
||||
| Ausblasstutzen | ||||||
Einzelwiderstände: Summe Stck*z = |
0,56 | Þ * pdy = |
81 Pa | Dp Einzelw. | ||
| Rohr (6m lang) | l = 6m |
R = 6 Pa/m |
l * R = |
36 Pa | Dp Rohr | |
| Filter laut Herstellerangaben | 1200 Pa | Dp Geräte | ||||
Druckdifferenz der Teilstrecke = |
1317 Pa | Dp Summe | ||||
Bezeichnung |
Stck |
z |
Stck*z |
Teilstr. Nr. 5 |
||
Ansaugstutzen |
|
|||||
Drosselklappe |
|
V in m3/h 7000 |
||||
Bogen 90° |
|
|||||
Bogen 60° |
|
Æ
in mm 450 |
||||
| Konus (Æ geschätzt) | 1 | 1,00 | 1,00 | |||
| w in m/s 12,5 |
||||||
Abzweigstück |
|
Pdy in Pa (Normalfall 0,6*w2) 94 |
||||
| Ausblasstutzen -Regenhaube | 1 | 1,00 | 1,00 | |||
Einzelwiderstände: Summe Stck*z = |
2,00 | Þ * pdy = |
188 Pa | Dp Einzelw. | ||
| Rohr (4m lang) | l = 4m |
R = 3,5 Pa/m |
l * R = |
14 Pa | Dp Rohr | |
| Schalldämpfer -laut Herstellerangaben | 18 Pa | Dp Geräte | ||||
Druckdifferenz der Teilstrecke = |
220 Pa | Dp Summe | ||||
2.4 Ermittlung der Gesamtdruckdifferenz der Anlage (D pgeA)
Bei verzweigten Rohrleitungen ist
derjenige Weg zu ermitteln, der den größten Druckverlust verursacht (Hauptstrang). Bei der Ermittlung der Druckdifferenzen pro Teilstrecke nach 2.3 brauchen erkennbare Nebenstrecken nicht berechnet werden, da sie für den Gesamtdruckverlust der Anlage nicht relevant sind. Zur Gesamtdruckdifferenz der Anlage gehören nicht nur die Ansaugleitungen, sondern auch die Ausblasleitung auch wenn sie nur aus dem Ventilatorstutzen besteht, da pdy hier immer verloren geht. |
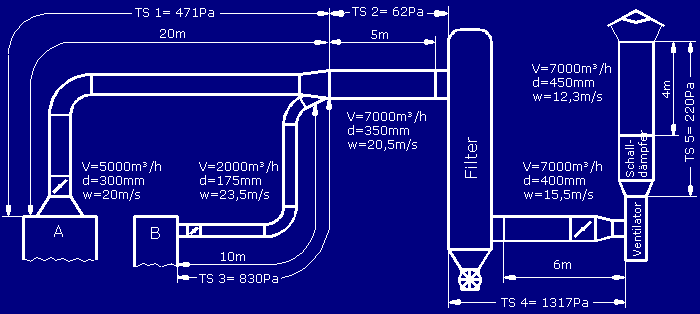
Die Teilstrecke 1 ist Nebenstrang und
für die Druckdifferenz des Ventilators unerheblich, da für die Teilstrecke 3 ein
höherer Differenzdruck erforderlich ist, der auch in TS 1 wirkt und dort eine Drosselung
erforderlich macht. |
Der Hauptstrang besteht aus TS
3; TS 2; TS 4 und TS 5.
Druckdifferenz der gesamten Anlage (D pgeA) = Hauptstrang:
| Teilstrecke 3 = | 830 Pa | Mit dem ermittelten Differenzdruck von 2429 Pa für die Anlage |
|
| Teilstrecke 2 = | 62 Pa | ||
| Teilstrecke 4 = | 1317 Pa | ||
| Teilstrecke 5 = | 220 Pa | ||
DpgeA = |
2429 Pa |
Der erforderliche Ventilator muss bei einem Volumenstrom von 7000 m3/h eine Druckerhöhung (Dpt) von mindestens DpgeA = 2429 Pa erzeugen können. (Punkt auf der Kennlinie des Ventilators). Die Bezeichnung Dpt wird für die totale Druckerhöhung (pdy+
pst)
des Ventilators zwischen Saug- und Druckstutzen verwendet. Eine Sicherheit von 10 bis 20% sollte vorhanden sein, da die Volumenströme nicht immer so einreguliert werden können, wie sie berechnet wurden, und auch um Unwägbarkeiten abzudecken. Ist für den Betriebspunkt bei den
verschiedenen Ventilatorkennlinien eine Auswahlmöglichkeit gegeben zwischen einer kleinen
Baugröße mit hoher Drehzahl und einer größeren mit niedriger Drehzahl, ist meist die
kleinere zu bevorzugen, da sie billiger ist und weniger Platz beansprucht. |
Ventilatoren-Kennlinie
|
Die Ventilatorkennlinie sollte möglichst steil verlaufen, damit bei einer Abweichung vom berechneten Druck, z.B. durch Filterverschmutzung, nur eine geringe Änderung des geplanten Volumenstroms auftritt. Bei den im allgemeinen eingesetzten
Radialventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln vermindert sich der
Leistungsbedarf, wenn durch höhere Druckdifferenzen der Volumenstrom reduziert wird.
Daher sollten größere Ventilatoren die Problemen durch Schweranlauf bereiten mit einer
Drosselkappe zum Rohrsystem versehen werden, die beim Anlaufen des Ventilators geschlossen
wird. |
|
Raumkrümmer erzeugen einen Drall des Luftstroms, der die Ventilatorenleistung sehr negativ beeinflussen kann. Sie sollten saugseitig mindestens 6 Durchmesser vom Ventilator entfernt sein, oder zwischen den beiden Bogen muss sich ein Rohr von der Länge 6 * Æ befinden. Auch ein 90° -Bogen sollte möglichst nicht direkt am Ventilatorsaugstutzen angebracht werden sondern zuerst das Konusstück auf den meist größeren Rohrleitungsdurchmesser. |
 |
2.5 Leistungsbedarf des
Ventilators
| Der Leistungsbedarf des Lüfters an der
Antriebswelle (PW) beträgt: Als Sicherheit (s) wurden 15% gewählt. |
||
| |
Wenn sich später im Betrieb zeigt,
dass
die Absaugung nicht die gewünschte Schutzgüte erreicht, weil gemachte Annahmen nicht
zutreffen, kann bei einem Ventilator mit Riemenantrieb oftmals eine kleinere Riemenscheibe
angebracht werden, so dass er schneller dreht und dadurch einen höheren Differenzdruck
und eine größere Luftmenge bringt. Wenn nur in einem einzelnen Strang die erforderliche Luftmenge nicht erreicht wird, ist es aus Energiegründen teilweise zweckmäßig hier einen zusätzlichen Ventilator einzubauen anstatt die Leistung des Hauptventilators zu erhöhen und alle anderen Stränge stärker zu drosseln. |
Proportionalitätsgesetze beim Ventilator:
Die Formel gibt, an dass eine
Ventilatordrehzahlerhöhung um 10% Bei einer nachträglichen Volumenstromvergrößerung über die Drehzahl wird bezüglich des Druckverlustanteils der Rohrleitung diese Druckerhöhung auch benötigt, da ihr Widerstand auch mit dem Quadrat der Luftgeschwindigkeit (w) ansteigt. |
(n = Ventilatordrehzahl) |
2.7 Überschlagsrechnung nach
Durchschnittsverlustwerten Tabelle 7.0
| Vergleich: | |||||
| Werte aus Beispiel 2.0: | Werte für überschlägige Bestimmung nach Tabelle 7.0 ermittelt: | ||||
| (Teilstrecke 1 = | 471 Pa*) | 20m Rohrleitung Æ 300 bei w=20 m/s | 20m * 50,2 Pa/m = | 1004 Pa | |
| Teilstrecke 2 = | 62 Pa | 5m Rohrleitung Æ 350 bei w= 20,5 m/s | 5m * ~ 50 Pa/m = | 250 Pa | |
| Teilstrecke 3 = | 830 Pa | (10m Rohrleitung Æ 175 bei w = 23,5 m/s | 10m * ~ 88 Pa/m = | 880 Pa*) | |
| Filter TS 4 = | 1200 Pa | Filter TS 4 = | 1200 Pa | ||
| Teilstrecke 4 = | 117 Pa | 6m Rohrleitung Æ 400 bei w= 15,5 m/s | 6m * ~ 28 Pa/m = | 168 Pa | |
| Schalld. TS 5= | 18 Pa | Schalld. TS 5 = | 18 Pa | ||
| Teilstrecke 5 = | 202 Pa | 4m Rohrleitung Æ 450 bei w= 12,3 m/s | 4m * ~ 17 Pa/m = | 68 Pa | |
DpgeA = |
2429 Pa | DpgeA = |
2708 Pa | ||
| (DpgeA) = Druckdifferenz der gesamten Anlage = Hauptstrang.
(*) = Nebenstrecken
|
|||||
Bei der Überschlagsrechnung ist für
die Teilstrecke 1 wegen der relativ langen, geraden Rohrleitung ein wesentlich höherer
Druckverlust ermittelt worden, als in Wirklichkeit vorhanden ist. |