|
1.0 Allgemeine Hinweise |
Für den Volumenstrom wurde das Formelzeichen V verwendet statt des gebräuchlichen ![]()
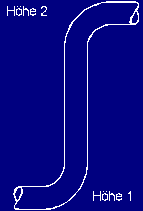 |
Da für den Normalfall als Fördermedium Luft vorausgesetzt wird, mit gleicher Dichte wie sie die Umgebungsatmosphäre aufweist, müssen im Gegensatz zu Flüssigkeiten Druckunterschiede, die aus den verschiedenen Höhenlagen der Rohrleitungen resultieren, nicht berücksichtigt werden. Siehe auch 10.8 |
|
|
| Bei Druck- und Temperaturdifferenzen, wie sie
in Absaug- und Belüftungsanlagen auftreten, kann die Volumenänderung der Luft
vernachlässigt werden. Der Volumenstrom ist dann konstant (V1=V2). Es gilt somit: A1 * w1 = A2 * w2 [1.1] |
1.2 Druck (p)
| In einer Rohrleitung, durch die ein Medium strömt, wird
unterschieden zwischen statischem Druck (pst) und dynamischem Druck (pdy) 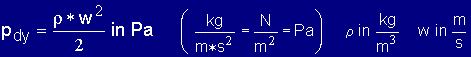 [1.3]
[1.3]Der statische Druck wirkt in alle Richtungen also auch auf die Rohrwand, während der dynamische nur in Flussrichtung wirkt, z.B. auf eine plötzlich in den Strom gehaltene Platte und der kinetischen Energie entspricht, die in der Bewegung des Mediums steckt |
| Da Luft von 20° C bei einem Luftdruck von 1013 mbar (Meereshöhe) eine Dichte von cirka 1,2 kg/m3 aufweist, ergibt sich für den Normalfall: |
pdy = 0,6 * w2 in Pa |
[1.4] |
| Der statische und der dynamische Druck ergeben den Gesamtdruck (pge). Wenn nicht anders erwähnt, sind Angaben auf den Gesamtdruck bzw. auf die Gesamtdruckdifferenz bezogen. | pge = pst + pdy |
[1.5] |
Würden
keine Verluste durch Wandreibung und innere Reibung (Wirbelbildung) auftreten, wäre unter
den oben genannten Einschränkungen der Gesamtdruck pge an allen Stellen einer
Rohrleitung gleich hoch. |
pst1 + pdy1 = pst2 + pdy2 |
[1.6] |
| Durch Reibungsverluste tritt in Flussrichtung eine Verminderung des Gesamtdrucks auf. Da pdy1 gleichgroß wie pdy2 ist, wenn keine Luftgeschwindigkeitsänderung auftritt, muss sich der statische Druck in gleicher Größe vermindern. |  pge1 - Dp = pge2 |
[1.7] |
Statischer Druck wird in dynamischen bzw. dynamischer Druck wird in statischen umgewandelt, wenn sich die Luftgeschwindigkeit ändert. Die Druckumwandlung (pum) beträgt: |
Normalfall: p Um = 0,6 * ( w12 - w22 ) |
[1.8] |
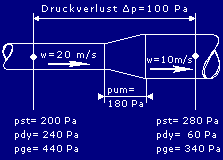 |
Die
Druckumwandlung nach Formel 1.8 von pum = 0,6*(202- 102)
= 180 Pa |
|
Der Druckverlust (Dp) von 100 Pa, hervorgerufen durch Wandreibung und innere Reibung (Wirbel), geht zu Lasten des statischen Drucks. Trotzdem hat er sich von anfänglich 200 auf 280 Pa erhöht, da dynamischer Druck in Höhe von 180 Pa in statischen Druck umgewandelt wurde |
||
| Verringerung der Luftgeschwindigkeit Erhöhung der Luftgeschwindigkeit |
= = |
Erhöhung des statischen Drucks Verminderung des statischen Drucks |
| Genutzt werden kann der dynamische Druckanteil z.B. bei Belüftungsleitungen, wenn bei gleichbleibenden Querschnitten durch abgehende Luftströme die Luftgeschwindigkeit geringer wird und sich dadurch dynamischer Druck in statischen umwandelt. |
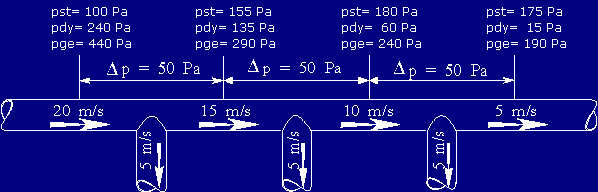 |
1.9 Druckbetrachtung Rohrleitung mit Ventilator

1.) Der dynamische Druck (pdy) mit 0,6 * 202 = 240 Pa im Ansaugrohr und 0,6 * 102 = 60 Pa im Ausblasrohr ist über die Luftgeschwindigkeit gegeben. 2.) Von beiden Rohrenden aus kann pge unter Berücksichtigung der Verluste durch Reibung für die jeweiligen Strecken bis zum Ventilator ermittelt werden. Der dazugehörende statische Druck ergibt sich aus pge - pdy = pst 3) Die erforderliche Gesamtdruckdifferenz
des Ventilators, auch als totale Druckerhöhung (Dpt) bezeichnet, von 270 Pa
ergibt sich aus der Differenz saugseitig von -140 Pa zu druckseitig +130 Pa. Im Beispielsfall tritt durch die
Druckumwandlung erst im Konusstück ein Überdruck in der Leitung auf. Bis dahin herrscht
auch auf der "Druckseite" des Ventilators Unterdruck! Dpt = 120+ 20+ 10+ 50 + 10+ 60* = 270 Pa. * Der dynamische Druckverlust des Ausblasstutzens ist in den entsprechenden Zeta-Werten für Ausblasrohre, Regenhauben usw. berücksichtigt und muss dann nicht extra hinzugerechnet werden. (siehe auch 8.6) Hätte der Ventilator eine geringere Gesamtdruckdifferenz (Dpt) als 270 Pa, könnte er die Luft nicht mit 20 m/s fördern und nicht den gewünschten Volumenstrom bringen. Bei einer höheren Druckdifferenz des Ventilators müssten zusätzliche Widerstände wie Drosselklappen vorgesehen werden, die den überschüssigen Druck verbrauchen. Verluste (z.B. durch Umlenkungen) im Ventilator selbst, sind bei den Druckangaben der Hersteller berücksichtigt. Widerstände durch die meist erforderlichen Übergänge auf die Rohrleitung müssen jedoch beachtet werden. Für die erforderliche Druckdifferenz, die der Ventilator erbringen muss, ist es im Normalfall gleichgültig, ob er am Anfang, am Ende oder irgendwo im Verlauf der Rohrleitung eingesetzt wird.
1.10 Druckverluste (Dp) Für gerade Rohre kann
der Druckverlust pro Meter Rohr aus Tabelle 6.0 entnommen werden. Bei Leitungen mit nicht
kreisförmigen Querschnitten, ist dabei der hydraulische Durchmesser [1.12] anzusetzen. Dp = z * pdy = z * r/2 * w2 Normalfall = z * 0,6 * w2 [1.11] Die Summe aller Druckverluste aus
geraden Rohrleitungen und Einzelwiderständen, |
1.12 Hydraulischer Durchmesser
Rohre, die keinen kreisförmigen Querschnitt aufweisen, müssen auf einen hydraulischen Durchmesser umgerechnet werden: dhyd = 4 * A / U ; Bei rechteckigen Querschnitten ergibt sich: dhyd = 2 * b * h / (b + h) Mit dem hydraulischen
Durchmesser kann der Druckverlust in Tabelle 6.0 abgelesen werden. |